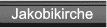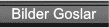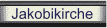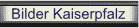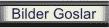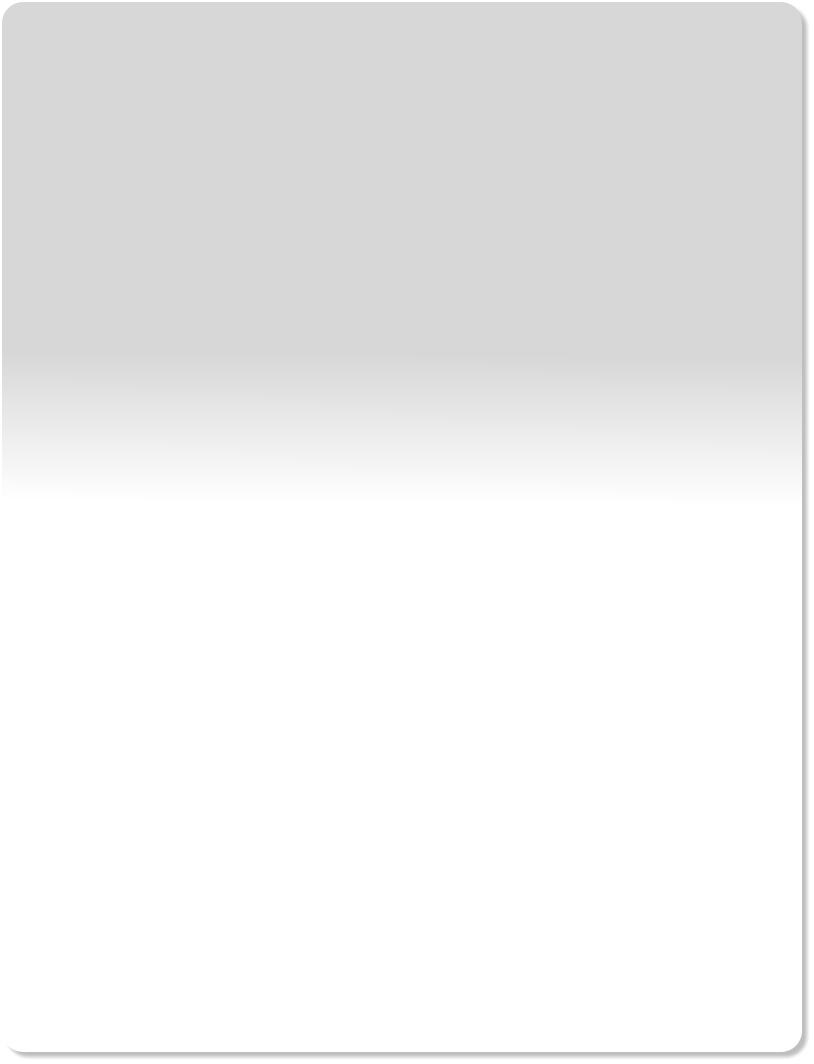
© Webdesign und Realisation: Peter Gericke 2000



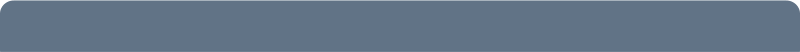
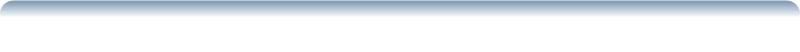
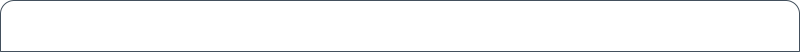
 Die St. Jakobikirche
Unter den Goslarer Altstadtkirchen ist die Kir-
che des hl. Jakobus seit dem Abriss der kaiser-
lichen Stiftskirche Simon und Judas, auch Kai-
serdom genannt, im Jahre 1819 das älteste
noch erhaltene Kirchengebäude. Sie bezieht
sich auf eine Urkunde des Hildesheimer Bi-
schofs Hezilo im Jahre 1073.Die St. Jakobi-
kirche ist vermutlich nicht als eine Gemeinde-
kirche entstanden, sondern als eine Kirche, mit
der der Hildesheimer Bischof in unmittelbarer
Nähe der bedeutenden Kaiserpfalz und inmit-
ten der sich erweiternden Stadt Goslar präsent sein wollte. Allerdings lässt schon die Namen-
gebung dieser Kirche darauf schließen, dass Goslarer Bürger, die zum Grab des Apostels Ja-
kobus des Älteren nach Santiago de Com-postela gepilgert waren, diese Kirche als die ihre
betrachteten und sie dem Patronat des hl. Jakobus unterstellten. Als freie Bürger der freien
Reichsstadt lehnten sie eine Einflussnahme aus Hildesheim ab. So wird sie sich sehr bald zur
Gemeindekirche der Bürger entwickelt haben, die sich in ihrem Umkreis ansiedelten und wurde
durch den großen Anteil an Handwerkern zur Kirche der Goslarer Gilden.Den Bedürfnissen und
dem Wachstum der St. Jakobigemeinde entsprechend wurde die Kirche durch Jahrhunderte
erweitert und gestaltet. In ihrer Geschichte spiegelt sich auch die Geschichte der Stadt Goslar
wider. So sind z. B. wesentliche bauliche Veränderungen an der St. Jakobikirche dann festzu-
stellen, wenn die Stadt durch den Ertrag des Erzabbaus am Rammelsberg aufblühte.In ihrem
ursprünglichen Zustande war die St. Jakobikirche eine flach gedeckte romanische Pfeiler-
basilika mit wechselnden Haupt- und Nebenpfeilern. Bereits im Jahre 1073 standen der Vier-
ungsbogen, der als einziger erhalten ist, und die Südmauern des Querschiffes, die heute den
Abschluss der Seitenschiffe bilden. Die Kirche des 11. Jahrhunderts war Ausgangspunkt der
späteren Umbauten und Erweiterungen. In der Gotik um 1250 wurde die Decke der Kirche mit
spitzbogigen Rippengewölben einge-wölbt. Die Hauptpfeiler er-hielten deshalb Vorlagen (Vor-
bauten) zur Aufnahme der Rippenansätze. Die Neben-pfeiler fielen fort. Noch vor 1300 wurde
ein neuer Chor im gotischen Stil erbaut.Die größte Veränderung erfährt die Kirche schließlich
um l500 durch die Umgestaltung zu einer Hallenkirche. Neue Außenmauern werden errichtet,
die schmalen romanischen Seiten-schiffe entfernt, die großen Durchbrüche zwischen Mittel-
schiff und Seitenschiffen geschaffen, und das Ganze von einem großen Dach überspannt. Den
Abschluss der Umbauten bildet im Jahre 1516 der Bau der südlichen Eingangshalle.Der auf-
merksame Beobachter der Kirche kann die vier Bauzeiten der Kirche noch an den einzelnen
Bauteilen von der romanischen bis zur spätgotischen Zeit deutlich erkennen.Die wuchtige
Westfront, deren Türme aus der Vier-eckform des Unterbaues über das Achteck zur Rundform
überleiten, ist noch romanisch und weist außen unter dem Rundbogenfries an ihren Nord und
Südecken eigenartige Reliefs (Meerweib, doppelköpfiger Löwe) auf. (Quelle st-jakobi)
Die St. Jakobikirche
Unter den Goslarer Altstadtkirchen ist die Kir-
che des hl. Jakobus seit dem Abriss der kaiser-
lichen Stiftskirche Simon und Judas, auch Kai-
serdom genannt, im Jahre 1819 das älteste
noch erhaltene Kirchengebäude. Sie bezieht
sich auf eine Urkunde des Hildesheimer Bi-
schofs Hezilo im Jahre 1073.Die St. Jakobi-
kirche ist vermutlich nicht als eine Gemeinde-
kirche entstanden, sondern als eine Kirche, mit
der der Hildesheimer Bischof in unmittelbarer
Nähe der bedeutenden Kaiserpfalz und inmit-
ten der sich erweiternden Stadt Goslar präsent sein wollte. Allerdings lässt schon die Namen-
gebung dieser Kirche darauf schließen, dass Goslarer Bürger, die zum Grab des Apostels Ja-
kobus des Älteren nach Santiago de Com-postela gepilgert waren, diese Kirche als die ihre
betrachteten und sie dem Patronat des hl. Jakobus unterstellten. Als freie Bürger der freien
Reichsstadt lehnten sie eine Einflussnahme aus Hildesheim ab. So wird sie sich sehr bald zur
Gemeindekirche der Bürger entwickelt haben, die sich in ihrem Umkreis ansiedelten und wurde
durch den großen Anteil an Handwerkern zur Kirche der Goslarer Gilden.Den Bedürfnissen und
dem Wachstum der St. Jakobigemeinde entsprechend wurde die Kirche durch Jahrhunderte
erweitert und gestaltet. In ihrer Geschichte spiegelt sich auch die Geschichte der Stadt Goslar
wider. So sind z. B. wesentliche bauliche Veränderungen an der St. Jakobikirche dann festzu-
stellen, wenn die Stadt durch den Ertrag des Erzabbaus am Rammelsberg aufblühte.In ihrem
ursprünglichen Zustande war die St. Jakobikirche eine flach gedeckte romanische Pfeiler-
basilika mit wechselnden Haupt- und Nebenpfeilern. Bereits im Jahre 1073 standen der Vier-
ungsbogen, der als einziger erhalten ist, und die Südmauern des Querschiffes, die heute den
Abschluss der Seitenschiffe bilden. Die Kirche des 11. Jahrhunderts war Ausgangspunkt der
späteren Umbauten und Erweiterungen. In der Gotik um 1250 wurde die Decke der Kirche mit
spitzbogigen Rippengewölben einge-wölbt. Die Hauptpfeiler er-hielten deshalb Vorlagen (Vor-
bauten) zur Aufnahme der Rippenansätze. Die Neben-pfeiler fielen fort. Noch vor 1300 wurde
ein neuer Chor im gotischen Stil erbaut.Die größte Veränderung erfährt die Kirche schließlich
um l500 durch die Umgestaltung zu einer Hallenkirche. Neue Außenmauern werden errichtet,
die schmalen romanischen Seiten-schiffe entfernt, die großen Durchbrüche zwischen Mittel-
schiff und Seitenschiffen geschaffen, und das Ganze von einem großen Dach überspannt. Den
Abschluss der Umbauten bildet im Jahre 1516 der Bau der südlichen Eingangshalle.Der auf-
merksame Beobachter der Kirche kann die vier Bauzeiten der Kirche noch an den einzelnen
Bauteilen von der romanischen bis zur spätgotischen Zeit deutlich erkennen.Die wuchtige
Westfront, deren Türme aus der Vier-eckform des Unterbaues über das Achteck zur Rundform
überleiten, ist noch romanisch und weist außen unter dem Rundbogenfries an ihren Nord und
Südecken eigenartige Reliefs (Meerweib, doppelköpfiger Löwe) auf. (Quelle st-jakobi)











 klick auf die Vorschaubilder
klick auf die Vorschaubilder







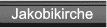
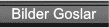

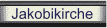
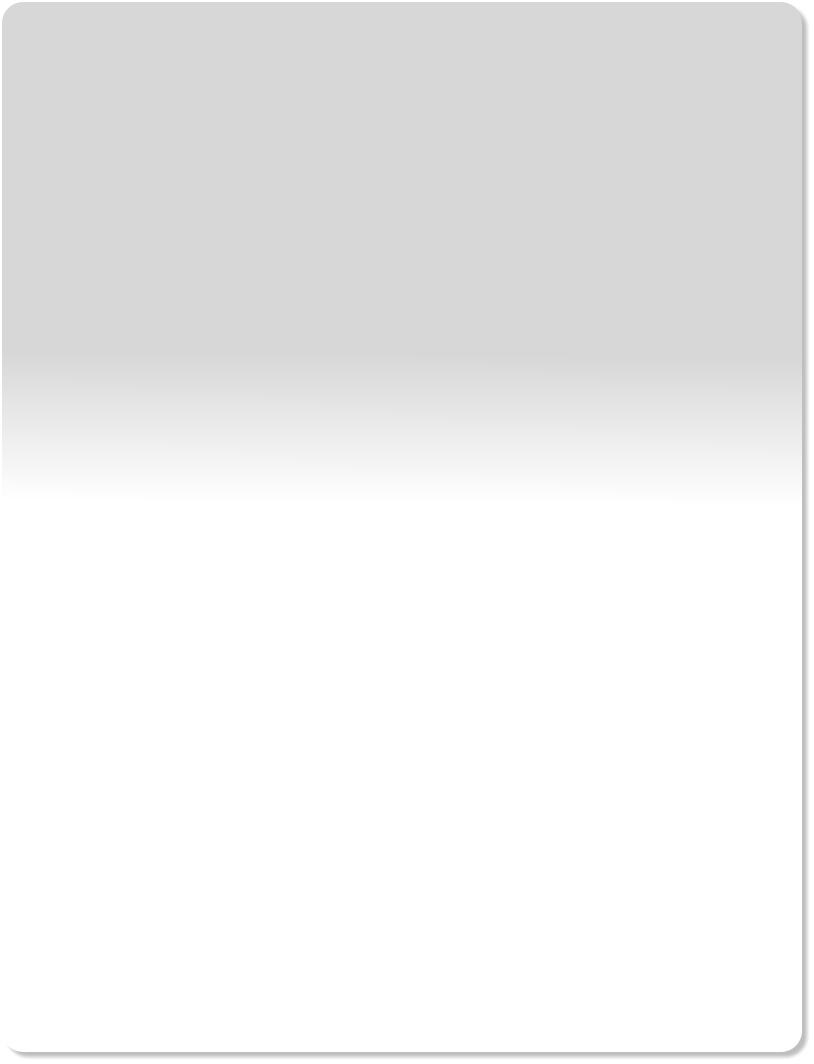
 © Webdesign und Realisation: Peter Gericke 2000
© Webdesign und Realisation: Peter Gericke 2000



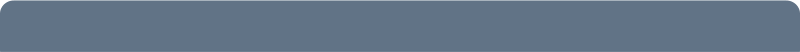
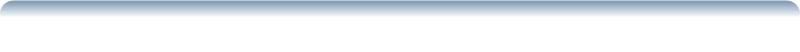
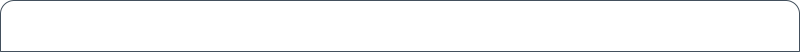
 Die St. Jakobikirche
Unter den Goslarer Altstadtkirchen ist die Kir-
che des hl. Jakobus seit dem Abriss der kaiser-
lichen Stiftskirche Simon und Judas, auch Kai-
serdom genannt, im Jahre 1819 das älteste
noch erhaltene Kirchengebäude. Sie bezieht
sich auf eine Urkunde des Hildesheimer Bi-
schofs Hezilo im Jahre 1073.Die St. Jakobi-
kirche ist vermutlich nicht als eine Gemeinde-
kirche entstanden, sondern als eine Kirche, mit
der der Hildesheimer Bischof in unmittelbarer
Nähe der bedeutenden Kaiserpfalz und inmit-
ten der sich erweiternden Stadt Goslar präsent sein wollte. Allerdings lässt schon die Namen-
gebung dieser Kirche darauf schließen, dass Goslarer Bürger, die zum Grab des Apostels Ja-
kobus des Älteren nach Santiago de Com-postela gepilgert waren, diese Kirche als die ihre
betrachteten und sie dem Patronat des hl. Jakobus unterstellten. Als freie Bürger der freien
Reichsstadt lehnten sie eine Einflussnahme aus Hildesheim ab. So wird sie sich sehr bald zur
Gemeindekirche der Bürger entwickelt haben, die sich in ihrem Umkreis ansiedelten und wurde
durch den großen Anteil an Handwerkern zur Kirche der Goslarer Gilden.Den Bedürfnissen und
dem Wachstum der St. Jakobigemeinde entsprechend wurde die Kirche durch Jahrhunderte
erweitert und gestaltet. In ihrer Geschichte spiegelt sich auch die Geschichte der Stadt Goslar
wider. So sind z. B. wesentliche bauliche Veränderungen an der St. Jakobikirche dann festzu-
stellen, wenn die Stadt durch den Ertrag des Erzabbaus am Rammelsberg aufblühte.In ihrem
ursprünglichen Zustande war die St. Jakobikirche eine flach gedeckte romanische Pfeiler-
basilika mit wechselnden Haupt- und Nebenpfeilern. Bereits im Jahre 1073 standen der Vier-
ungsbogen, der als einziger erhalten ist, und die Südmauern des Querschiffes, die heute den
Abschluss der Seitenschiffe bilden. Die Kirche des 11. Jahrhunderts war Ausgangspunkt der
späteren Umbauten und Erweiterungen. In der Gotik um 1250 wurde die Decke der Kirche mit
spitzbogigen Rippengewölben einge-wölbt. Die Hauptpfeiler er-hielten deshalb Vorlagen (Vor-
bauten) zur Aufnahme der Rippenansätze. Die Neben-pfeiler fielen fort. Noch vor 1300 wurde
ein neuer Chor im gotischen Stil erbaut.Die größte Veränderung erfährt die Kirche schließlich
um l500 durch die Umgestaltung zu einer Hallenkirche. Neue Außenmauern werden errichtet,
die schmalen romanischen Seiten-schiffe entfernt, die großen Durchbrüche zwischen Mittel-
schiff und Seitenschiffen geschaffen, und das Ganze von einem großen Dach überspannt. Den
Abschluss der Umbauten bildet im Jahre 1516 der Bau der südlichen Eingangshalle.Der auf-
merksame Beobachter der Kirche kann die vier Bauzeiten der Kirche noch an den einzelnen
Bauteilen von der romanischen bis zur spätgotischen Zeit deutlich erkennen.Die wuchtige
Westfront, deren Türme aus der Vier-eckform des Unterbaues über das Achteck zur Rundform
überleiten, ist noch romanisch und weist außen unter dem Rundbogenfries an ihren Nord und
Südecken eigenartige Reliefs (Meerweib, doppelköpfiger Löwe) auf. (Quelle st-jakobi)
Die St. Jakobikirche
Unter den Goslarer Altstadtkirchen ist die Kir-
che des hl. Jakobus seit dem Abriss der kaiser-
lichen Stiftskirche Simon und Judas, auch Kai-
serdom genannt, im Jahre 1819 das älteste
noch erhaltene Kirchengebäude. Sie bezieht
sich auf eine Urkunde des Hildesheimer Bi-
schofs Hezilo im Jahre 1073.Die St. Jakobi-
kirche ist vermutlich nicht als eine Gemeinde-
kirche entstanden, sondern als eine Kirche, mit
der der Hildesheimer Bischof in unmittelbarer
Nähe der bedeutenden Kaiserpfalz und inmit-
ten der sich erweiternden Stadt Goslar präsent sein wollte. Allerdings lässt schon die Namen-
gebung dieser Kirche darauf schließen, dass Goslarer Bürger, die zum Grab des Apostels Ja-
kobus des Älteren nach Santiago de Com-postela gepilgert waren, diese Kirche als die ihre
betrachteten und sie dem Patronat des hl. Jakobus unterstellten. Als freie Bürger der freien
Reichsstadt lehnten sie eine Einflussnahme aus Hildesheim ab. So wird sie sich sehr bald zur
Gemeindekirche der Bürger entwickelt haben, die sich in ihrem Umkreis ansiedelten und wurde
durch den großen Anteil an Handwerkern zur Kirche der Goslarer Gilden.Den Bedürfnissen und
dem Wachstum der St. Jakobigemeinde entsprechend wurde die Kirche durch Jahrhunderte
erweitert und gestaltet. In ihrer Geschichte spiegelt sich auch die Geschichte der Stadt Goslar
wider. So sind z. B. wesentliche bauliche Veränderungen an der St. Jakobikirche dann festzu-
stellen, wenn die Stadt durch den Ertrag des Erzabbaus am Rammelsberg aufblühte.In ihrem
ursprünglichen Zustande war die St. Jakobikirche eine flach gedeckte romanische Pfeiler-
basilika mit wechselnden Haupt- und Nebenpfeilern. Bereits im Jahre 1073 standen der Vier-
ungsbogen, der als einziger erhalten ist, und die Südmauern des Querschiffes, die heute den
Abschluss der Seitenschiffe bilden. Die Kirche des 11. Jahrhunderts war Ausgangspunkt der
späteren Umbauten und Erweiterungen. In der Gotik um 1250 wurde die Decke der Kirche mit
spitzbogigen Rippengewölben einge-wölbt. Die Hauptpfeiler er-hielten deshalb Vorlagen (Vor-
bauten) zur Aufnahme der Rippenansätze. Die Neben-pfeiler fielen fort. Noch vor 1300 wurde
ein neuer Chor im gotischen Stil erbaut.Die größte Veränderung erfährt die Kirche schließlich
um l500 durch die Umgestaltung zu einer Hallenkirche. Neue Außenmauern werden errichtet,
die schmalen romanischen Seiten-schiffe entfernt, die großen Durchbrüche zwischen Mittel-
schiff und Seitenschiffen geschaffen, und das Ganze von einem großen Dach überspannt. Den
Abschluss der Umbauten bildet im Jahre 1516 der Bau der südlichen Eingangshalle.Der auf-
merksame Beobachter der Kirche kann die vier Bauzeiten der Kirche noch an den einzelnen
Bauteilen von der romanischen bis zur spätgotischen Zeit deutlich erkennen.Die wuchtige
Westfront, deren Türme aus der Vier-eckform des Unterbaues über das Achteck zur Rundform
überleiten, ist noch romanisch und weist außen unter dem Rundbogenfries an ihren Nord und
Südecken eigenartige Reliefs (Meerweib, doppelköpfiger Löwe) auf. (Quelle st-jakobi)











 klick auf die Vorschaubilder
klick auf die Vorschaubilder